- Das Institut
- Forschung
- Diktaturen im 20. Jahrhundert
- Demokratien und ihr historisches Selbstverständnis
- Transformationen in der neuesten Zeitgeschichte
- Internationale und transnationale Beziehungen
- Editionen
- Dissertationsprojekte
- Abgeschlossene Projekte
- Dokumentation Obersalzberg
- Zentrum für Holocaust-Studien
- Berliner Kolleg Kalter Krieg
- Publikationen
- Vierteljahrshefte
- Archiv
- Bibliothek
- Zentrum für Holocaust-Studien
- Aktuelles
- Termine
- Presse
- Neuerscheinungen
- Aus dem Institut
- Themen
- Spielfilm im Nationalsozialismus
- Die Geschichte des Bundesministeriums der Finanzen (1945-1990)
- Reordering Yugoslavia, Rethinking Europe
- 75 Jahre Institut für Zeitgeschichte
- München 1972
- Confronting Decline
- Digitale Zeitgeschichte
- Zeitgeschichte Open
- Das Deutsche Verkehrswesen
- Bundeskanzleramt
- Demokratische Kultur und NS-Vergangenheit
- Geschichte der Treuhandanstalt
- Akten zur Auswärtigen Politik
- Dokumentation Obersalzberg
- Edition "Mein Kampf"
- "Man hört, man spricht"
- Newsletter
- Termine
- Presse
- Neuerscheinungen
- Aus dem Institut
- Themen
- Spielfilm im Nationalsozialismus
- Die Geschichte des Bundesministeriums der Finanzen (1945-1990)
- Reordering Yugoslavia, Rethinking Europe
- 75 Jahre Institut für Zeitgeschichte
- München 1972
- Confronting Decline
- Digitale Zeitgeschichte
- Zeitgeschichte Open
- Das Deutsche Verkehrswesen
- Bundeskanzleramt
- Demokratische Kultur und NS-Vergangenheit
- Geschichte der Treuhandanstalt
- Akten zur Auswärtigen Politik
- Dokumentation Obersalzberg
- Edition "Mein Kampf"
- "Man hört, man spricht"
- Newsletter
Demokratische Kultur und NS-Vergangenheit
Politik, Personal, Prägungen in Bayern 1945-1975
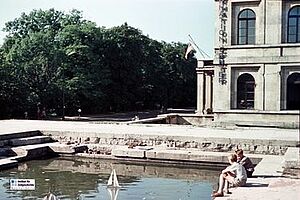
Wie sind Bayerns Ministerien und Behörden nach 1945 mit ihrer nationalsozialistischen Vergangenheit umgegangen – welche Brüche und Kontinuitäten prägten den demokratischen Neuanfang? Dies hat das Institut für Zeitgeschichte (IfZ) in seinem Projekt "Demokratische Kultur und NS-Vergangenheit. Politik, Personal, Prägungen in Bayern 1945-1975" erforscht. In Gang gesetzt wurde das Projekt durch einen einstimmigen Beschluss aller Fraktionen des Bayerischen Landtags, finanziert wurde es durch den Freistaat Bayern. Der Landtagsbeschluss garantierte die Freiheit und Unabhängigkeit der wissenschaftlichen Arbeit sowie einen uneingeschränkten Aktenzugang und einen ergebnisoffenen Forschungsauftrag. Eine Kommission namhafter Zeit- und Landeshistorikerinnen und -historiker hat das Vorhaben beraten und begleitet. Sie bestand aus Helmut Flachenecker (Würzburg), Sabine Freitag (Bamberg), Ferdinand Kramer (München), Bernhard Löffler (Regensburg), Joachim Scholtyseck (Bonn), Georg Seiderer (Erlangen) und Margit Szöllösi-Janze (München).
Spezifika des Projekts

Inhaltlich schloss das Projekt an das seit einigen Jahren stark gestiegene Interesse am Umgang der obersten Bundes- und Landesbehörden mit NS-Belastungen an. Doch beschränkte es sich nicht, wie dies meistens der Fall ist, auf eine Institution: Erstmals wurde stattdessen der personelle und funktionale Gesamtzusammenhang einer Landesregierung von der Ministeriumsspitze bis hinunter auf die Vollzugsebene in den Blick genommen. Für einen solchen Ansatz bietet sich Bayern als Untersuchungsfeld an, denn als einziges großes Flächenland behielt der Freistaat sein Territorium nahezu unverändert und konnte zudem an eine gewachsene historische Identität anknüpfen. Hand in Hand damit ging ein hohes Maß administrativer Kontinuität. Obwohl die Staatsregierung während der NS-Diktatur Kompetenzen eingebüßt hatte, stand 1945 ein ausdifferenzierter behördlicher Apparat und ein Stamm bayerischer Staatsbeamter für den demokratischen Neuaufbau zur Verfügung. Doch viele von ihnen hatten bereits zwischen 1933 und 1945 als Verwaltungsangehörige den Verfolgungsdruck des NS-Staats auf Regimegegner erhöht, ihre berufliche Sozialisation ging zum Teil noch auf die autoritären Verhältnisse der Monarchie zurück. Wie etablierte sich trotz personeller, mentaler und institutioneller Kontinuitäten zur NS-Diktatur eine demokratische Regierungs- und Verwaltungspraxis?
Um diese Frage zu beantworten, wurden erstens Karriereverläufe, individuelle Prägungen und Personalpolitik analysiert. Zweitens ging es um Verwaltungspraxis, Leitideen und Handlungsroutinen. Drittens wurde untersucht, wie die unterschiedlichen Akteursgruppen ihre Vergangenheit(en) deuteten und welche internen und öffentlichen Auseinandersetzungen sich damit verbanden. Dieser Ansatz verschränkte die Perspektiven auf Akteure, Handeln und Wahrnehmungen systematisch. Dadurch wurde es möglich, den Begriff der "NS-Belastung" neu zu fassen und von seiner unbefriedigenden Bindung an formale Kriterien wie Mitgliedschaft in NS-Organisationen zu lösen. Der Untersuchungszeitraum ermöglichte es, längerfristige Entwicklungen in den Blick zu nehmen und den Umgang mit der NS-Vergangenheit demokratiegeschichtlich zu rahmen. Auf diese Weise wurde es möglich, das Verständnis von „Demokratie“ und von „NS-Belastung“ gleichermaßen zu historisieren und die entsprechenden Wandlungsprozesse aufeinander zu beziehen. Während der Schwerpunkt auf langfristigen Wandlungsprozessen der politischen Kultur nach 1945 lag, umfasste die Analyse je nach Handlungsfeld und Personensample nicht nur die Jahre der NS-Herrschaft, sondern auch die für die politische und habituelle Sozialisation vieler Akteure formative Phase der Weimarer Republik. Die Auswahl der näher untersuchten Handlungsfelder konzentrierte sich auf Gebiete, die in die Kompetenz der Bundesländer fielen.
Eine ausführlichere Einführung in das Projekt ist im April 2017 in den Vierteljahrsheften für Zeitgeschichte erschienen:"Demokratische Kultur und NS-Vergangenheit in Bayern".
Welche Bereiche wurden untersucht?

Im Oktober 2016 begann die erste Projektphase mit Studien, die wichtige Institutionen als Handlungsorte in den Blick nahmen: die Staatskanzlei, das Finanzministerium, Landeskriminalamt und Verfassungsschutz sowie das öffentliche Gesundheitswesen. Auf eigener finanzieller Grundlage, aber inhaltlich und organisatorisch in den Forschungsverbund integriert entstanden zwei weitere Arbeiten über das Justizministerium und das Bayerische Statistische Landesamt. Im April 2020 folgte die zweite Projektphase. Sie legte den Akzent stärker auf Politikfelder, die einen zentralen Stellenwert für die Demokratisierung nach 1945 hatten: die Schulpolitik des Kultusministeriums, die Polizeiausbildung und den Umgang mit ehemaligen NS-Vermögen. Ressortübergreifend wurde außerdem die Rolle der Frauen in der bayerischen Ministerialverwaltung untersucht.
2023 ist das Projekt ausgelaufen. Seine Ergebnisse werden in einer eigenen Reihe bei De Gruyter Oldenbourg veröffentlicht. Eine Zusammenfassung der Projektergebnisse finden Sie hier als PDF (Demokratische Kultur und NS-Vergangenheit Gesamtergebnisse).
Aktuelle Aktivitäten
Am 9. Oktober 2024 präsentierte das IfZ die Ergebnisse des Verbundprojekts im Ausschuss für Wissenschaft und Kunst des Bayerischen Landtags. Abgeordnete aller Fraktionen zollten bei dieser Gelegenheit der Forschungsarbeit des IfZ große Anerkennung und regten an, die Projektergebnisse auf weiteren Wegen als den Monografien der Öffentlichkeit zu vermitteln.
Am 31. März wird Ana Lena Werners Monografie über „Landesjustiz und NS-Vergangenheit. Justizbilder und Verwaltungspraxis im bayerischen Justizministerium in der Nachkriegszeit“ im Bayerischen Staatsministerium der Justiz der Öffentlichkeit vorgestellt.
Die nächste Monografie aus dem Gesamtprojekt wird am 6. Juni erscheinen. Es ist die Studie von Felix Lieb über „Tradition und Demokratie. Das bayerische Kultusministerium, seine Schulpolitik und die NS-Vergangenheit 1945–1975“.
Auch das Buch von Jürgen Kilian über das „Haus der Zahlen. Die bayerische Landesstatistik zwischen Diktatur und Demokratie“ wird in diesem Jahr publiziert. Das statische Landesamt, das IfZ und der Autor präsentieren die Ergebnisse am 12. September am Hauptsitz des Statistischen Landesamts in Fürth.
Publikationen

Rick Tazelaar
Hüter des Freistaats. Das Führungspersonal der Bayerischen Staatskanzlei zwischen Nationalsozialismus und Nachkriegsdemokratie
Demokratische Kultur und NS-Vergangenheit. Politik, Personal, Prägungen in Bayern 1945-1975
Berlin 2023
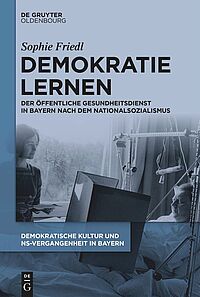
Sophie Friedl
Demokratie lernen. Der Öffentliche Gesundheitsdienst in Bayern nach dem Nationalsozialismus
Demokratische Kultur und NS-Vergangenheit. Politik, Personal, Prägungen in Bayern 1945-1975
Berlin 2024

Ana Lena Werner
Landesjustiz und NS-Vergangenheit. Justizbilder und Verwaltungspraxis im bayerischen Justizministerium in der Nachkriegszeit
Demokratische Kultur und NS-Vergangenheit. Politik, Personal, Prägungen in Bayern 1945-1975
Berlin 2024
Bildnachweis:
Bild 1: Hugo Jaeger, IfZ-BA-00022378
Bild 2: IfZ-BA-00020102-308
Bild 2: Bayerische Staatsbibliothek München/Bildarchiv
Titelbild: Bearbeitung von Entnazifizierungsvorgängen und Vorbereitung von Spruchkammerverfahren in Nürnberg 1947, bpk / Hanns Hubmann


